 Frühstück
im Atelier
Frühstück
im Atelier
Eduard Manet (1832-1883)
1868, Größe 118,3 x 154 m, Öl auf Leinwand,
Neue Pinakothek, München
von Alev Lenz, Jahrgangsstufe 12
| Luitpold-Gymnasium München Leistungskurs Kunsterziehung |
 Frühstück
im Atelier Frühstück
im Atelier
Eduard Manet (1832-1883) 1868, Größe 118,3 x 154 m, Öl auf Leinwand, Neue Pinakothek, München von Alev Lenz, Jahrgangsstufe 12 |
| Das Bild gibt mir das Gefühl, einer in Gedanken erstarrten Situation beizuwohnen. Als Betrachter fühlt man in seinen Gedanken ebenso isoliert, wie die dargestellten Personen, deren Beisammensein so charakterisiert ist, daß jeder für sich ist, seinen Gedanken nachhängt. Regt einen das Bild dadurch vielleicht zum Nachdenken über sich selbst an, indem es keinen Einbezug in die Gedanken der anderen Personen bietet? Läßt diese Isolierung, diese „Uneinbezogenheit“ Freiraum zur Selbstreflektion oder fühlt sich der Betrachter einfach nur allein, vielleicht sogar beleidigt und wendet sich vom Bild ab? Ich, für meine Person, bleibe an diesem Bild hängen und lasse mich, gerade weil die an mir vorbeigehenden Blicke nicht unbedingt einladend wirken, von der melancholischen Stimmung forttragen. |
Manet malte dieses
Bild im Jahre 1868. Er nannte es „Le déjeuner dans l’atelier“. Das
Bild ist, wovon der Titel eher ablenkt, wohl ein Portrait des unehelichen
Sohnes der Pianistin Suzanne Leenhoff, Lèon Koella-Leenhoff, dessen
Vater Manet wahrscheinlich selber war. Zu sehen sind drei Personen, von
denen ein junger Dandy, Lèon, die Hauptfigur abgibt. Halb sitzt
er, halb lehnt er an der vorderen Tischkante. Alles andere ist ihm zu-
und untergeordnet. Wie zum Beispiel die beiden anderen Personen, ein
Zigarrenrauchernder Herr und eine Bedienstete, die beide im Hintergrund
stehen. Ebenfalls im Hintergrund, aber relativ auffällig im Gegensatz
zu dem Herrn und der Frau, befinden sich ein bunter, mit Vögeln verzierter
Blumentopf, sowie eine Fenstertür und eine Landkarte, die eher mit
dem Hintergrund verschwimmen. Stuhl und Tisch sind mit zahlreichen Gegenständen
stillebenartig gedeckt. Reste vom eben erst beendeten Frühstück
finden sich rechts auf dem Tisch und ein Ensemble historischer Waffen,
Helm und Säbel befinden sich links auf einem Sessel. Auf diesem Sessel
sitzt aber auch eine leicht zu übersehende, sich putzende Katze. Nicht
nur die Katze ist mit sich selbst beschäftigt, sondern auch die im
Raum befindlichen Personen. Der Herr raucht und bläst in einer stillen
Aktion Rauchwolken in die Luft. Ebenso Aktionsarm erscheint die Bedienstete,
die gerade mit einer Kaffekanne beschäftigt zu sein scheint. Allen
gemeinsam ist ein erstarrter Blick, der irgendwohin in gedankenversunkene
Ferne schweift. ein
Zigarrenrauchernder Herr und eine Bedienstete, die beide im Hintergrund
stehen. Ebenfalls im Hintergrund, aber relativ auffällig im Gegensatz
zu dem Herrn und der Frau, befinden sich ein bunter, mit Vögeln verzierter
Blumentopf, sowie eine Fenstertür und eine Landkarte, die eher mit
dem Hintergrund verschwimmen. Stuhl und Tisch sind mit zahlreichen Gegenständen
stillebenartig gedeckt. Reste vom eben erst beendeten Frühstück
finden sich rechts auf dem Tisch und ein Ensemble historischer Waffen,
Helm und Säbel befinden sich links auf einem Sessel. Auf diesem Sessel
sitzt aber auch eine leicht zu übersehende, sich putzende Katze. Nicht
nur die Katze ist mit sich selbst beschäftigt, sondern auch die im
Raum befindlichen Personen. Der Herr raucht und bläst in einer stillen
Aktion Rauchwolken in die Luft. Ebenso Aktionsarm erscheint die Bedienstete,
die gerade mit einer Kaffekanne beschäftigt zu sein scheint. Allen
gemeinsam ist ein erstarrter Blick, der irgendwohin in gedankenversunkene
Ferne schweift. |
Die
Bildfläche erhält durch Betonung horizontaler und vertikaler
Bildlinien eine ruhige, statische Wirkung. Ganz deutlich wird diese Konstellation
beim Fensterrahmen und der Landkarte, die parallele Linien und rechte Winkel
zum Tisch ausbilden. Die Körper der drei Personen zerteilen als vertikale
Achsen die querformatige Bildfläche. Diese relativ strenge Architektur
reflektiert Ausgewogenheit, Ruhe und Richtigkeit der Situation. Zahlreiche
gebogene und runde Formen kontrastieren die rechtwinklige Ordnung: der
in der linken Bildecke lehnende Säbel, der Helm, der Arm der Bediensteten
und die Katze, die wirklich fast kreisrund ist sowie die Köpfe und
der große Topf für den Gummibaum. Ein  exemplarisch
wirkendes Bildelement für die von Manet offenbar gewünschte Balance,
aber auch Spannung der Komposition findet sich auf dem Frühstückstisch.
Das Messer als gerades, flaches, auch rechteckiges Element steht im Gegensatz
zur sich unmittelbar daneben befindenden Zitrone, die durch ihre spiralenförmig
aufgeschnittene Schale eine perfekt Rundheit beschreibt. exemplarisch
wirkendes Bildelement für die von Manet offenbar gewünschte Balance,
aber auch Spannung der Komposition findet sich auf dem Frühstückstisch.
Das Messer als gerades, flaches, auch rechteckiges Element steht im Gegensatz
zur sich unmittelbar daneben befindenden Zitrone, die durch ihre spiralenförmig
aufgeschnittene Schale eine perfekt Rundheit beschreibt. |
Die Ausrichtung des
Gewehrs und des Messers im Vordergrund des Raumes zielen beide nach hinten
in den Bildraum. Der Hintergrund enthält glatte, waagerechte und senkrechte
Linien, keine Form und Richtung suchenden Linien, den Stamm des Gummibaumes,
die Fensterbalken (quer und senkrecht ) und den Rahmen der Landkarte an
der Wand. Dadurch wirkt der Hintergrund geregelt und aufgeräumt, fast
langweilig.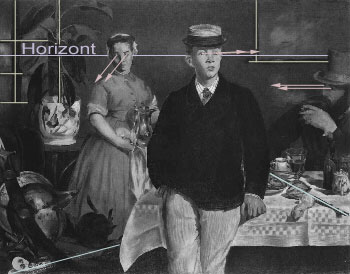 Der
Vordergrund bietet jedoch eine Verdichtung von Material und (Aus-)Richtungen.
Das Messer, das als Messer natürlich scharf ist, und das Gewehr, das
ebenfalls Bedrohung oder Gefahr ausstrahlt, bilden eine gewisse Spannung
in Richtung des Jungen. Der
Vordergrund bietet jedoch eine Verdichtung von Material und (Aus-)Richtungen.
Das Messer, das als Messer natürlich scharf ist, und das Gewehr, das
ebenfalls Bedrohung oder Gefahr ausstrahlt, bilden eine gewisse Spannung
in Richtung des Jungen.
Die Raumillusion erreicht Manet damit, daß die im Hintergrund stehenden Dinge und Personen verschwimmen, wie beim fotografischen Effekt der begrenzten Schärfentiefe. Somit bildet er eine Distanz zwischen den Personen aus. Das Gesicht des Jungen steht im Vordergrund und ist detailiert und sehr gut zu erkennen. Die Personen sind hintereinander aufgereiht und bilden etwas kulissenhaftes auf engem Raum. Es wirkt alles wie ein Bühnenbild für den monumental, fast in Bildmitte aufgestellten Jungen. Ein Horizont, oder Linien die zu einem Fluchtpunkt führen, sind in diesem Bild von keinem geometrischen Gegenstand beschrieben. 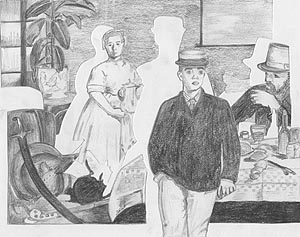 Der
Blick kann sich Linien suchen, Linien die in den Raum hineinführen.
Angefangen bei dem Jungen, weiterführend über die Bedienstete
und den alten Mann zum Blumentopf. Abschließend zur Wand. Linien
die der Größe und Raumordnung der Dinge folgen. So verhält
es sich mit dem Horizont. Er bildet sich kurz unterhalb der Augen des Jungen
und der Bediensteten, ist aber nicht eindeutig festzustellen. Diese Augen
liegen auf gleicher Höhe, da sie aber über den Betrachter hinwegblicken
macht man den Horizont, somit den Standpunkt des Betrachters und seine
Augenhöhe, unmittelbar unter den Augen fest. Eine wichtige Rolle spielen
eben diese Blicke und Augen bezüglich des Betrachters. Da kein Augenkontakt
zu den frontal auf den Betrachter orientierten Personen im Bild besteht,
fühlt sich der Betrachter etwas verloren. Sein Blick kann sich nirgends
festhalten. Er verläuft möglicherweise von den hellen Punkten
des Bildes über das Gesicht des Jungen, das Gesicht der Bediensteten,
den Blumentopf, die Tischdecke, die Hand des Mannes hinweg zu den dunklen
Flächen die man genauer betrachten muß; doch bietet keiner dieser
Punkte halt. Nichts nimmt direkten Bezug zum Betrachter auf. Der Blick
des Jungen schweift über ihn hinweg, wodurch zusätzlich noch
ein leicht arroganter Touch entsteht. Die Bedienstete scheint uns anzusehen,
doch verliert sich ihr Blick ebenfalls. Zwar in Richtung des Betrachters,
aber auf den Jungen gerichtet, durch ihn hindurchblickend. In einer ebenso
melancholischen Weise wie auch der Junge durch seine scheinbare Arroganz
beschrieben ist. Der Raucher sieht nicht einmal in unsere Richtung. Sein
Blick verliert sich entlang des Zigarrenrauches zum linken Bildrand hin.
Ersichtlich ist nun daß nichts Bezug auf den Betrachter nimmt, daß
nicht einmal die Personen im Bild zueinander Bezug aufnehmen. Ihre Blicke
sind nachdenklich verloren. Sie stehen für sich allein und lassen
somit auch den Betrachter allein. Der
Blick kann sich Linien suchen, Linien die in den Raum hineinführen.
Angefangen bei dem Jungen, weiterführend über die Bedienstete
und den alten Mann zum Blumentopf. Abschließend zur Wand. Linien
die der Größe und Raumordnung der Dinge folgen. So verhält
es sich mit dem Horizont. Er bildet sich kurz unterhalb der Augen des Jungen
und der Bediensteten, ist aber nicht eindeutig festzustellen. Diese Augen
liegen auf gleicher Höhe, da sie aber über den Betrachter hinwegblicken
macht man den Horizont, somit den Standpunkt des Betrachters und seine
Augenhöhe, unmittelbar unter den Augen fest. Eine wichtige Rolle spielen
eben diese Blicke und Augen bezüglich des Betrachters. Da kein Augenkontakt
zu den frontal auf den Betrachter orientierten Personen im Bild besteht,
fühlt sich der Betrachter etwas verloren. Sein Blick kann sich nirgends
festhalten. Er verläuft möglicherweise von den hellen Punkten
des Bildes über das Gesicht des Jungen, das Gesicht der Bediensteten,
den Blumentopf, die Tischdecke, die Hand des Mannes hinweg zu den dunklen
Flächen die man genauer betrachten muß; doch bietet keiner dieser
Punkte halt. Nichts nimmt direkten Bezug zum Betrachter auf. Der Blick
des Jungen schweift über ihn hinweg, wodurch zusätzlich noch
ein leicht arroganter Touch entsteht. Die Bedienstete scheint uns anzusehen,
doch verliert sich ihr Blick ebenfalls. Zwar in Richtung des Betrachters,
aber auf den Jungen gerichtet, durch ihn hindurchblickend. In einer ebenso
melancholischen Weise wie auch der Junge durch seine scheinbare Arroganz
beschrieben ist. Der Raucher sieht nicht einmal in unsere Richtung. Sein
Blick verliert sich entlang des Zigarrenrauches zum linken Bildrand hin.
Ersichtlich ist nun daß nichts Bezug auf den Betrachter nimmt, daß
nicht einmal die Personen im Bild zueinander Bezug aufnehmen. Ihre Blicke
sind nachdenklich verloren. Sie stehen für sich allein und lassen
somit auch den Betrachter allein.
Diese melancholische, ruhige, erstarrte Stimmung wird zusätzlich von der Katze betont. Sie wendet sich von uns ab und ihrem Hinterteil zu. Ihr Putzen macht uns, durch das Wissen, daß Katzen sich nur bei Ruhe putzen, erneut auf den nachdenklichen ruhigen Stillstand des Bildes aufmerksam. Der Betrachter allerdings ist von dieser Situation distanziert, ja gar ausgeschlossen, und fühlt sich verloren. |
Diese Eindrücke
werden nicht nur durch die Anordnung der Personen und ihrer melancholischen
nachdenklichen Blicke, sondern auch durch die Wahl der Farben unterstützt.
In der Mitte stellt der Junge einen schwarzen Farbklecks dar. Er bildet
den dunklen Hauptton im Bild. Die hellen Stellen, der Frühstückstisch,
die Hand des Mannes, das Gesicht des Jungen, das Gesicht der Bediensteten
und der Blumentopf, eventuell noch der Knauf des Gewehres, bilden, wie
schon erwähnt, erste Augenfänger für den Betrachter und
akzentuieren durch ihr optisches Hervortreten auch die eigentliche dunkle
Farbwahl. Man könnte sagen; die Ausnahme bestätigt die Regel.
Die Wahl der Farbe hebt aber auch den Jungen als Hauptthema hervor. Bei
ihm sind die stärksten und reinsten Farben gewählt und er ist
am detailliertesten durch diese Farben formuliert. Die Farben sind auch
in den Bereichen Hell/Dunkel am „unvermischtesten“ ( siehe verschwommene
Farben und Farbübergänge bei der Bediensteten ), bilden somit
den stärksten Kontrast aus und ziehen große Aufmerksamkeit auf
sich. Die Farben vermischen sich eben nicht, wie sie es bei den im Hintergrund
stehenden Dingen und
Personen tun, um deren Hintergründigkeit zu betonen. Manet ist beim
Malen und Gestalten des Jungen sehr fein und sehr genau vorgegangen. Dingen und
Personen tun, um deren Hintergründigkeit zu betonen. Manet ist beim
Malen und Gestalten des Jungen sehr fein und sehr genau vorgegangen.
Die nachdenkliche, melancholische, gedämpfte Stimmung der Personen spiegelt sich in der Farbwahl wieder. Vor allem durch den dunklen Raumabschluss ( Wand ). Es entsteht durch diese Farbwahl eine gedämpfte Stimmung, aber auch eine Ruhe, die nicht nur über dunklen Ton erklärbar ist, sondern durchaus auch physisch zu begründen: Dunkle Töne tun dem Auge nicht weh, reizen es nicht. Man kann sie lange anschauen. Die hellen Akzente, die Licht von der rechten Seite her beschreiben, wirken etwas auffrischend in dieser melancholisch gedämpften Stimmung. Auch lenkt die Farbwahl den Blick des Betrachters in den Raum hinein, von der Lichtquelle her bis zum abschließenden Blumentopf. Dieser trägt erneut bei zur Auffrischung des Ganzen. Man könnte annehmen, daß er, als festes Dingsymbol sozusagen, die normal Situation beschreibt (das normale Leben, eine Pflanze verkörpert ja irgendwo auch das Leben), die, den bunten Farben nach zu urteilen, eher fröhlich ist, und läßt diese erstarrte Situation als Ausnahme erscheinen. |
| Auf dem Bild sind drei
Personen zu erkennen. Die Hauptperson ist, wie schon erkannt, der Junge.
Er ist der typische Dandy. Er verbindet Eleganz und Lässigkeit durch
seine Haltung genauso wie durch schicke, aber lockere Kleidung. Er ist,
so nimmt man an, der uneheliche Sohn Manets, den er schon des öfteren
gezeichnet und germalt hat. Die weiteren Personen sind in den Hintergrund
gerückt und damit eher unwichtig. Die Bedienstete ist eben nur eine
Bedienstete die in Gedanken verloren ist. Allerdings könnte man ihr
auch eine etwas wichtigere Rolle zusprechen, die durch die Katze im Bild
unterstützt wird. Die Katze, die das mystische und geheimnissvolle
in der Frau repräsentiert, könnte einen auf die Idee bringen,
daß dem männlichen Übergewicht im Bild ein weibliches Gegengewicht
kontrastiert werden sollte.
Der Raucher hingegen unterstützt durch seine Ruhe und sein nachdenkliches Rauchen, die Stimmung im Bild. Er bläßt den Rauch in den Raum hinein, wie es alle drei mit ihren Gedanken zu tun scheinen. Als Modell ist zunächst der Malerkollege Monet gesessen, später dann der Maler Auguste Rouselin. Durch die identifizierbaren Personen erhält das Bild auch eine biografische Dimension. Alle drei stehen, sitzen und lehnen in erstarrter, aber nicht ungemütlich scheinender Position und strahlen nachdenkliche Ruhe aus.Selbst die Katze, die zwar in putzender Bewegung 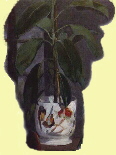 ist,
strahlt das aus. Katzen putzen sich nur, wenn es ruhig ist und sie sich
wohl fühlen. Der ungewöhnlich bunte Blumentopf verdient Beachtung.
Er hellt das Bild auf und läßt auf einen normalerweise lebhaften
Alltag schließen. Außerdem finden wir noch ein für ein
Frühstückszimmer ungewöhnlich drapiertes Waffenstillleben.
Die Spannung die hier von ausgeht ist,
strahlt das aus. Katzen putzen sich nur, wenn es ruhig ist und sie sich
wohl fühlen. Der ungewöhnlich bunte Blumentopf verdient Beachtung.
Er hellt das Bild auf und läßt auf einen normalerweise lebhaften
Alltag schließen. Außerdem finden wir noch ein für ein
Frühstückszimmer ungewöhnlich drapiertes Waffenstillleben.
Die Spannung die hier von ausgeht wurde schon beschrieben, ebenso die Kullissenhaftigkeit, Theatralik der
ganzen Situation. Man könnte es hier noch in Verbindung bringen mit
dem Charakter des Hausherren. Es ist ein Versatzstück für militärsche
Ordnung, eventuell Erziehung, da die Waffen wie Requisiten für den
Jungen wirken. Historisch orientiert. Auch könnte das Gewehr zur Jagd
dienen, was in Frankreich ein bürgerliches Recht ist. Natürlich
bietet nicht nur das Waffenstillleben
wurde schon beschrieben, ebenso die Kullissenhaftigkeit, Theatralik der
ganzen Situation. Man könnte es hier noch in Verbindung bringen mit
dem Charakter des Hausherren. Es ist ein Versatzstück für militärsche
Ordnung, eventuell Erziehung, da die Waffen wie Requisiten für den
Jungen wirken. Historisch orientiert. Auch könnte das Gewehr zur Jagd
dienen, was in Frankreich ein bürgerliches Recht ist. Natürlich
bietet nicht nur das Waffenstillleben Rückschlüsse auf einen gut Bürgerlichen, wohlhabenden Familienstand.
Der junge Dandy, wie schon erwähnt, eine gehaltene Bedienstete und
das üppige Frühstück. Austern mit Zitrone, Kaffee und ein
scheinbar alkoholisches Getränk stehen für guten Geschmack und
französischem Gourmetverhalten gehobenen Standes.
Rückschlüsse auf einen gut Bürgerlichen, wohlhabenden Familienstand.
Der junge Dandy, wie schon erwähnt, eine gehaltene Bedienstete und
das üppige Frühstück. Austern mit Zitrone, Kaffee und ein
scheinbar alkoholisches Getränk stehen für guten Geschmack und
französischem Gourmetverhalten gehobenen Standes. |
| Alles in allem zeigen
uns diese Bildgegenstände in ihrem Zusammenwirken durch Farbe und
in ihrer Anordnung einen scheinbar geregelten, ordentlichen und geschmackvollen
Haushalt, in dem für einen Moment -den meiner Meinung nach Manet perfekt
zum Ausdruck gebracht hat- der Zwang zur stilvollen Repräsentation,
wie man ihn halt so empfindet als gut bürgerlicher Franzose, umgewandelt
wird in einen kurzen melancholischen Moment, der zur Besinnung und zur
Konzentrarion auf sich, nach Innen, führt. Die Außenwelt gerät
für einen Moment in Vergessenheit.
Genau das passiert auch, wie am Anfang gemutmaßt, mit dem Betrachter. |
| Literatur:
Manet bis Van Gogh, Hugo von Tschudi und der Kampf um die Moderne; Herrausgegeben von Johann Georg Prinz von Hohenzollern und Peter- Klaus Schuster; Prestelverlag, Katalog zur Austellung 1996-1997. |